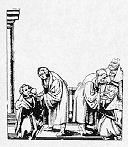
Deutschland um 1521
Brandgeruch hing in der Luft, und dabei war es doch wenige Jahre zuvor so ruhig gewesen im Lande. Wohl zu keiner Zeit waren die Deutschen so mit sich und der Welt im reinen wie zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Vor allem mit der römischen Kirche gab es keine Probleme mehr. Die großen Häresien und Kirchenspaltungen, die das Mittelalter immer wieder erschüttert hatten, waren überwunden.
Und wem war das zu danken?
Den Deutschen, die in den Deutschen Oekumenischen Konzilien des 15. Jahrhunderts - den einzigen, die jemals im Lande stattfanden - für Ordnung gesorgt hatten. Vor allem in Konstanz hatte man es den anderen gezeigt. Drei miteinander streitende Päpste hatten wir mit unserem Kaiser Siegmund an der Spitze davongejagt, einen neuen gewählt und damit das Papsttum gerettet; die häretischen englischen Wiclifiten hatten wir verurteilt, den tschechischen Ketzer Jan Hus verbrannt und die hussitischen Heere in jahrzehntelangen Kriegen auf deutschem Boden besiegt.Die große Einheit des Heiligen Reiches, des mittelalterlichen Gottesstaates, war hergestellt, die Deutschen mit sich sehr zufrieden.
Aber nun war einer aufgestanden, der zweifelte diese Selbstgerechtigkeiten an. "Das walt` die Sucht", rief ganz erschrocken der sächsische Herzog Georg, gut katholischer Enkel eines Hussitenkönigs, als der Mönch Luther behauptete, nicht alle Schriften des Erzketzers aus Böhmen seien unchristlich gewesen und seine Hinrichtung zeuge gegen seine Henker, denn "es ist nicht der Wille des Heiligen Geistes, daß Ketzer brennen sollen". Hatte der Wittenberger damit sein eigenes Todesurteil gesprochen? Es schien so, denn Rom verurteilte diesen Satz als "beleidigend für fromme Ohren", fing an, seine Schriften zu verbrennen und drohte mit dem Bann. Luther seinerseits antwortete mit der berühmten Aktion vom 10. Dezember 1520: Auf dem Schindanger vor den Toren Wittenbergs übergab er die päpstliche Bulle samt dem ganzen kirchlichen Recht dem Feuer. Der Bruch war da, die Machtstellung der Kirche symbolisch und real vernichtet. Luther selbst sah in den Flammen des von seinen Schülern entfachten Feuers seinen eigenen Tod auf dem Scheiterhaufen präfiguriert.
Aber Deutschland stellte sich diesmal nicht wie im Fall Hus gegen
den Ketzer sondern hinter ihn. Hatte der päpstliche Nuntius
noch im Dezember 1520 nach Rom geschrieben: "Das Volk bessert
sich zusehends", schrieb er im Februar 1521: "Dies ist
nicht mehr das katholische Deutschland von früher. Für
neun Zehntel ist das Feldgeschrei "Luther" und für
die übrigen wenigstens "Tod der römischen Kurie".

Die Botschaft von der Mündigkeit des einzelnen
Was hatte "das Volk" so fasziniert? Nichts anderes als die Botschaft von der Mündigkeit des einzelnen, von der Unmittelbarkeit zu Gott, vom unendlichen Wert des eigenen Gewissens auch gegenüber allen Autoritäten. "Wider das Gewissen etwas zu tun, ist weder sicher noch heilsam. Gott helfe mir", so wird Luther das vor dem Kaiser formulieren.